|
Aufführung
|

22. 3. 2003
(Première)
*
Musikalische Leitung: Nello Santi
Inszenierung: Gilbert Deflo
Ausstattung: William Orlandi
Choreographie:Berta Vallribera
Mir
Lichtgestaltung: Hans Rudolf Kunz
Chor:
Jürg
Hämmerli
La Gioconda: Sylvie Valayre
Laura Adorno: Mariana Pentcheva
La Cieca: Francesca Franci
Enzo Grimaldi: Walter Fraccaro
Barnaba: Juan Pons
Alvise Badoero: Roberto Scandiuzzi
Zuàne / voce: Giuseppe
Scorsin
Isèpo / voce: Miroslav
Christoff
Un cantore: Sergey Aksenov
Un Bernabotto: Valeriy Murga
Un pilota: Hartmut Kriszun
Chor, Zusatzchor und Kinderchor des
Opernhauses Zürich
Statistenchor des Opernhhauses Zürich
Orchester der
Oper Zürich
SYNOPSIS /
LIBRETTO  italiano italiano
 deutsch
deutsch
|
|
Rezensionen
|
|
|

24. 3. 2003
Leidenschaftliche
Konflikte, taubenblau
«La
Gioconda» im Opernhaus Zürich
Hinter allem steht
Übervater Verdi. Der Oper «La Gioconda» von Arrigo
Boito (Libretto) und Amilcare Ponchielli (Komposition) ist die
Auseinandersetzung mit Verdi, mit der «Aida»-Musik
durchaus anzumerken (vgl. NZZ, Beilage Literatur und Kunst,
22./23. 3. 03). Nicht alles ist geglückt; man
spürt, dass Librettist und Komponist um die Form gerungen haben.
Das Handlungsgeflecht im ersten Akt ist kompliziert. Da muss man
Ponchielli Achtung zollen, wie er es musikalisch auf die
klarstmögliche Weise darstellt. Das Geschehen im zweiten Akt
entfaltet sich dramaturgisch nicht optimal und weist Längen auf.
Musikalisch hat Ponchielli Stellen voller dramatischer Spannung
geschaffen, etliche Passagen lassen bereits an Puccini denken. Doch
plötzlich gleitet er in einen formelhaften Ton hinüber, der
fern von der visionären Sprache ist, welche das Libretto ihm
vorschlägt.
Ein Werk des stilistischen Übergangs und der
Suche nach neuen musiktheatralischen Lösungen also. Und ein
Werk, das fünf oder sechs grosse Rollen anbietet. Was die
Darstellerinnen der Gioconda, der Laura, von La Cieca oder die
Darsteller des Intriganten und Denunzianten Barnaba, des Inquisitors
Alvise (Lauras Mann gegen ihren Willen) und des in Laura verliebten
Enzo stimmlich und an grossen Auftritten in dem vier umfangreiche
Akte langen Stück zu leisten haben, ist enorm. Gross und
leidenschaftlich sind die Konflikte auf der Bühne, womit die
Oper ihr Publikum stark berühren kann. Ist dies bei der Premiere
im Opernhaus Zürich geschehen? Das Publikum reagierte eher
zurückhaltend auf eine etwas künstlich und unfertig
wirkende Inszenierung.
Wenig Bewegung
Die Bühne von William Orlandi überzeugte.
Er zeigt stilisiert und auf klare Zeichen reduziert den Ort der
Handlung mit weiten Horizonten, Meer und bewölkten Himmeln:
Venedig. Doch ist es nicht das glänzende Venedig, in Grau- und
Taubenblautönen hat es Orlandi gehalten. Ebenso die
Kostüme: Seltener findet sich darin etwas dunkles Rot. Mit dazu
heftig kontrastierendem Leuchten lässt einem das Bild des
dritten Aktes in der «Cà d'Oro» den Atem stocken.
Ein riesiger Goldvorhang in gleissendem Licht dominiert die Szene,
und er lässt den von Alvise verordneten Selbstmord Lauras
während Festivitäten und Ballettauftritten umso
eindringlicher wirken. Auf dieser Bühne gruppiert Gilbert Deflo
die Personen nicht minder stilisiert, auch mit dem Zweck, sie in
sängerisch vorteilhafte Positionen zu bringen. Es herrscht wenig
Bewegung, die Bilder wirken oft statisch wenn nicht gar starr. In den
besten Momenten kommt in Massenszenen etwas italienisches Ambiente
auf. Da tut das grosse Ballett, der Tanz der Stunden im dritten Akt,
gut. Vor der öffentlichen Katastrophe wird entspannt, die Musik
ist zart, und in Berta Vallribera Mirs Choreographie ist
plötzlich Phantasie im Umgang mit Bewegung auf der Bühne zu
spüren. Gerade dies lässt Deflo vermissen. Wie seine
Protagonistinnen und Protagonisten agieren, wirkt etwas
konzeptlos.
Die Damen spielen befreiter und überzeugender
als die Herren, die in schematischen, tradierten Belcanto-Operngesten
gefangen zu sein scheinen. Der Tenor Walter Fraccaro als Enzo
interpretiert seinen Part mit Hochdruck, Strahl- und
Durchschlagskraft, aber auch etwas monochrom. Differenzierte
gestalterische Fähigkeiten kommen vor allem im mittleren
Register und im mezza voce zum Tragen. Der gute Enzo wäre
verliebt; umarmt er indes seine Laura, fehlt sinnliche Ausstrahlung.
Unterschiedlich wirkt der Bariton von Juan Pons als Barnaba: Er kann
einen auf unglaubliche Weise packen und dann plötzlich wieder
kühl lassen. Wie angespannt muss die emotionelle Situation
für Alvise zu Beginn des dritten Aktes sein, denn gleich wird er
seiner Frau den Gift-Selbstmord befehlen.
Peinlichkeiten
Bei Roberto Scandiuzzi ist davon nicht viel zu
spüren. Er sorgt primär dafür, seinen Bass so
wohlklingend wie möglich über die Bühne zu
projizieren. Gestalterisch und spielerisch wäre hier mehr
Involviertheit mit dem Inhalt der Szene zu erwarten. Deflos
Inszenierung hat leider auch peinliche Stellen. Wie die zwei
Gondolieri im letzten Akt die scheintote Laura mit Ach und Krach aus
der Gondel hieven, ist prekär; es kicherte das ganze Haus.
Dafür müsste eine Inszenierung schleunigst eine andere
Lösung finden. Beim Selbstmord von Gioconda fliegt der Dolch
grotesk über die Bühne und stört die Dramatik des
Augenblicks ganz empfindlich. Der Auftritt des Regatta-Verlierers im
ersten Akt, Giuseppe Scorsin, ist hilflos überzeichnet. Und so
weiter.
Umso mehr freute man sich an der weichen, warmen und dennoch
alles überstrahlenden Sopranstimme von Sylvie Valayre (Gioconda)
und ihren überlegenen gestalterischen Fähigkeiten. Wie sie
im letzten Akt Stimmfarbe und Emotion eins werden liess, ist von
einmaliger Qualität. Nicht weniger zu bieten hat Mariana
Pentcheva, welche mit ihrem wunderbaren Mezzosopran Laura als eine
vielschichtige und differenzierte Person zeichnete. Das bewegende
Timbre der Altstimme von Francesca Franci als blinder Mutter der
Gioconda (La Cieca) passt genau zu dieser Rolle. Grosse Aufgaben
hatte der von Jürg Hämmerli hervorragend vorbereitete Chor
zu erfüllen, und er tat dies souverän. Und das Orchester
der Oper unter der musikalischen Gesamtleitung eines Meisters des
Stils, Nello Santi, bewältigte die auch oft solistischen
Aufgaben hervorragend und begleitete das Bühnengeschehen mit
Initiative und schönem Atem.
|
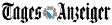
24. 3. 2003
Sehr pittoreske
Opernleidenschaften
Ein Melodram mit Schauer und Tanz:
Amilcare Ponchiellis Oper «La Gioconda» ist ein
kulinarisches Mehrgangmenü. Am Samstag hatte sie in Zürich
Premiere.
Von Thomas Meyer
Federleicht ist der «Tanz der Stunden»,
der berühmteste, neujahrskonzertkompatible Abschnitt der Oper.
In luftig-anmutigen Bewegungen erzählen zehn junge
Tänzerinnen von der Ballettschule für das Opernhaus
(Choreografie: Berta Vallribera Mir) von Idylle und Glück. Und
das, obwohl sie diesen Tanz vor einem Machtmenschen, dem skrupellosen
Staatsinquisitor Alvise, vorführen. Die hellen Glöckchen
des Balletts werden bald von Totenglocken abgelöst werden. Dann
nimmt das düstere Drama seinen Lauf.
Der «Tanz der Stunden» wäre so ein
Moment des Innehaltens, der zeitlosen Utopie, des schönen
Scheins von Kunst auch in einer grausamen Welt. Wenn diese
Inszenierung zumindest eine Ahnung davon vermitteln würde! Die
Tänzerinnen jedoch, das ist symptomatisch, werden sich am
Schluss ihrer Darbietung zum Publikum hin präsentieren und nicht
zum Inquisitor hin, in dessen Haus sie auftreten. Und so wird der
Tanz vollends eine Einlage zur Unterhaltung des Publikums, einst
bestimmt für die ballettrattenliebenden älteren Herren im
Parkett. Das Stück kippt so hübsch aus dem Drama.
Das kleine Beispiel macht deutlich, in welche
Richtung die Neuinszenierung von «La Gioconda» angelegt
ist: als pittoreske Choreografie aufs Publikum zu, nicht in das wie
auch immer geartete Drama hinein. Dieses Drama freilich ist ohnehin
nicht so stark wie beim grossen Zeitgenossen Verdi oder bei
Ponchiellis Schüler Puccini. Es ist ein typisch verwickeltes,
psychologisch kaum mehr plausibles Liebes- und Intrigen-Drama, mit
einem Bösewicht (Barnaba) als Katalysator, einem hehren
Liebespaar (Laura und Enzo), das sich schliesslich sogar findet, und
einer unglücklich Liebenden, die sich aber aufopfert, der
Gioconda des Titels eben, wobei man zumindest an diesem Abend nie
erfährt, warum die Figur diesen Übernamen (die Heitere)
trägt.
Das liesse sich zumindest in einen Strudel von
Leidenschaft hineintreiben, der Librettist Arrigo Boito, der
später erfolgreich für Verdi arbeitete, hatte es darauf
angelegt. Aber manches, was in der Handlung angelegt ist, machte der
Komponist Amilcare Ponchielli (1834-1886) nur auf einer oberen Ebene
wahr, in die Tiefe vermochte er nicht vorzudringen. Er verfügte
jenseits der gewiss souverän gehandhabten Konventionen jener
Zeit nicht über die Mittel der Charakterisierung und Zuspitzung.
So muss sein bekanntestes Werk wohl zweitrangig bleiben, aber es
bietet doch allerhand, was eine Aufführung rechtfertigen mag.
Allerhand Touristisches aus Venedig
Das Werk - Melodram und Prunkstück in einem -
nutzt die Theatermittel geschickt und ausgiebig, und der Zürcher
Regisseur Gilbert Deflo und sein Team rücken diesen Aspekt in
den Vordergrund: Grand Opéra à l’italienne. Hier
wurden Elemente des venezianischen Karnevals und auch sonst allerhand
Touristisches wie Markusplatz, Gondeln und Schiffe von Boito
zielsicher eingebaut. William Orlandi bringt die entsprechende
Ausstattung mit pittoresken Bildern:Arkaden wie auf einem Bild von
Giorgio de Chirico neben einem weitaus weniger stilisierten Himmel,
ein prächtiger Goldvorhang im Ballsaal, eine fotorealistisch
vernebelte Vedute der Stadt, Empire-Kostüme, Trauergondeln,
alles bunt gemixt, ohne Konzept auf Bildwirkung angelegt, mal
schaurig, mal frisch und gelegentlich unfreiwillig komisch. Hinzu
kommen grosse Chorpartien, besagtes Ballett, erregt leidenschaftliche
Ensembleszenen, ergreifend zerrissene Monologe, die sich statisch und
klischeehaft an der Rampe vorne austragen lassen. Das funktioniert
durchaus.
So ergeben sich oft weite Räume, die zwar
choreografisch, aber kaum darstellerisch genutzt werden. Okay, wenn
dabei genügend Platz bleibt fürs Singen, denn
offensichtlich will Deflo vor allem eine Plattform für die
Stimmen schaffen. Dirigent Nello Santi bereitet dem mit dem
Opernorchester einen farbigen, sicheren Boden. Das klingt zumindest
stets lebendig und durchpulst und in keinem Moment so bemüht,
wie es auf der jüngsten Aufnahme mit Marcello Viotti
stellenweise wirkt. Nun ja, an der Präzision, vor allem mit dem
von Jürg Hämmerli einstudierten Opernchor, wäre in
Zürich noch zu arbeiten, aber das Ganze trägt auf
natürliche Weise - mit einer Natürlichkeit, die Deflos
Personenführung im Szenischen nie erreicht. Und es ist
melodramatisch effektvoll, auch wenn es psychologisch einiges
schuldig bleibt. Wie viele Gefühle durchlebt nicht allein die
Gioconda in ihrem letzten grossen Monolog? Sylvie Valayre
interpretiert diese Figur facettenreich und engagiert. Sie
überzeugt mit schönen Tiefen und einer
selbstverständlichen Phrasierung. Einzig bei den hohen
Ausbrüchen wirkt ihre Stimme etwas angestrengt und im Ensemble
zu dominant.
Die beiden anderen Frauenrollen können sich
etwas weniger profilieren, vielleicht weil die vorgesehenen
Sängerinnen kurzfristig ausfielen. Die gefühlvoll
interpretierende Mariana Pentcheva sprang deshalb als Laura ein,
Francesca Franci sang die alte blinde Mutter der Gioconda.
Darstellerisch ist das wohl noch steigerungsbedürftig, aber in
dieser Hinsicht geben diese Rollen ohnehin weniger her als die
männlichen Widerparte.
Joviale Diabolik
Roberto Scandiuzzi als grausamer Alvise (er singt die Partie
auch unter Viotti) bot dabei die vokal und mimisch rundeste
Darstellung. Walter Fraccaro als Enzo bestach vor allem durch seine
intensive, ja feine Vortragsweise, gerade in der grossen Arie im 2.
Akt. Der Bösewicht Barnaba schliesslich, der für Boito eine
Vorahnung des Jago gewesen sein muss, wirkt bei Juan Pons von Stimme
und Postur her imposant. Ganz glauben mag man ihm freilich seinen
Diabolismus nicht: Er wirkt zuweilen eher jovial denn
hintergründig. So sicher diese Leistungen sind, so fügt
sich das Ensemble doch nicht ganz zusammen. Der Eindruck bleibt wie
ja auch im Szenischen disparat, aber vielleicht ist diese
Heterogenität ja ein Grundzug des Stücks.
|

24. 3. 2003
Laue Beziehungskiste
VON RICO HANDLE
Eifersucht, Gewalt und Intrigen beherrschen
Amlicare Ponchiellis Oper »La Gieconda». Im Zürcher
Opernhaus bleibt von der Dramatik nicht viel übrig. Premiere war
am Samstag.
Der Bösewicht Barnaba liebt Gioconda, diese
himmelt Enzo an, der aber Laura zugeneigt ist. Da Laura bereits
verheiratet ist, nimmt die Beziehungskiste immer grössere
Ausmasse an. Die Beteiligten schrecken vor keinem Mittel zurück,
um als Sieger hervorzugehen. Es kommt zu Entführungen,
Handgreiflichkeiten und versuchtem Mord. Am Schluss können Enzo
und Laura gemeinsam fliehen, Gioconda nimmt sich das Leben.
Dem Text der einzigen Oper von Amilcare Ponchielli
(1834-1886) liegt Victor Hugos Drama «Angelo, Tyrann von
Padua» zugrunde. Die Tragödie spielt in Venedig und bietet
eigentlich genug Stoff für einen spannenden Theaterabend.
Doch Regisseur Gilbert Deflo lässt in seiner klassischen
Inszenierung die Sänger kläglich allein. Jeden
Gemütszustand stellen sie mit derselben pathetischen Pose
dar. Ob Wut, Hilflosigkeit oder Liebeskummer, immer wirken sie
mit ihren ausgebreiteten Armen, als ob ihnen gleich das Herz
zerreissen würde. Dies macht das Stück kraft- und
wirkungslos. Sinnbildlich für die uninspirierte
Regieführung: Enzo steckt sein Schiff in Brand. Es brennt
lichterloh - doch die Besatzung bleibt stehen, als ob nichts
geschehen wäre.
Als Einziger bringt der italienische Dingent Nello
Santi (71) Leidenschaft ins Spiel. Der Altmeister und
frühere Dirigent des Radio-Symphonieorchesters Basel leitet mit
gewaltiger Inbrunst das Orchester. Er lebt die Musik so stark mit,
dass es dauernd wirkt, als würde er gleich selber
lossingen.
Ponchiellis eingehende Musik wird überzeugend
vorgetragen. Die Vorstellung ist aber durch die einfallslose Regie
nicht viel mehr als ein Konzert mit Kostümen und Kulissen.
Entsprechend enttäuscht reagierte das Publikum an der Premiere:
Der Schlussapplaus reichte kaum für den zweiten
Vorhang.
|

24. 3. 2003
Träge Stimmung
über der Lagune
Schöne Musik,
schöne Bilder, Nello Santi am Pult und nicht sehr herausragende
Stimmen. Zu den bezwingendsten Abenden im Opernhaus Zürich
gehörte die «Gioconda» an diesem Wochenende nicht.
Herbert Büttiker
«Cielo e mar», die Romanze des Tenors,
«Suicidio», die Arie des Soprans, die «Danza delle
Ore», das Glanzstück des Orchesters haben aus gutem Grund
ihre Karriere auch im Konzert gemacht. Einprägsame Musik
enthält Amilcare Ponchiellis einziges auf den Bühnen
präsent gebliebenes Hauptwerk von 1876 zuhauf. Auch Bariton und
Bass haben ihre glänzende solistische Plattform, packende Duette
und ein breit angelegtes Concertato mit Chor und Solisten kommen
hinzu, und auch für sich hat der Chor in Volksszenen
wirkungsvolle musikalische Auftritte. Das alles ist freilich
über einem Drama gebaut, das zwar von keinem Geringeren als
Arrigo Boito stammt, aber dessen für Verdi geschriebene
Shakespeare-Libretti bei weitem nicht erreicht. Victor Hugos stark
bearbeitetes Stück ist nicht der grosse Stoff, und die Figuren
scheinen sich weniger in ihrer Geschichte zu verwirklichen und
darzustellen, als eine solche zu manipulieren, um ein vorgegebenes
Figurenprofil zu demonstrieren. Auftritte und Abgänge gerade zur
rechten Zeit, das richtige «Werkzeug» stets zur Hand
– die Zufälle, die sich in grossen Stücken zur
Notwendigkeit des Dramas fügen, weisen hier eher auf die
schwache Glaubwürdigkeit der Figuren hin. Vielleicht auch
deswegen – und nicht nur wegen der hochgeschraubten
sängerischen Anforderungen – war «La Gioconda»
immer ein Werk der grossen Stars und ihrer Magie, auch ein Stück
der spektakulären Inszenierungskunst, und – wie sich jetzt
in Zürich zeigt – kein Repertoirestück für
solides Niveau und gutes Mittelmass.
Schleppend
Ein solches herrschte an dieser Premiere denn doch
über weite Strecken und erklärte vielleicht auch das
Phänomen, dass der Applaus zwar dezidiert anerkennend war, aber
eben doch – nach einem lastenden, gut dreieinhalbstündigen
Abend – schnell enden wollend. Gefeiert wurde vorab Nello Santi,
der allerdings da und dort (die Holzbläser zwischen den beiden
Strophen der Romanze) fast ein wenig buchstabieren liess und
insgesamt schon zügiger vorangegangen ist als an diesem Abend,
an dem er den gut disponierten grosse Apparat von Chor und Orchester
manchmal schleppend, oft aber auch mit sensibler Klangfülle
aufblühend agieren liess.
Forciertes Volumen herrschte hingegen öfters im
solistischen Bereich. Roberto Scandiuzzis Alvise geriet darob
vielleicht einförmiger, als diese eindimensional angelegte
Bassfigur ohnehin ist, während der Bariton Juan Pons das
finstere Auftrumpfen des Barnaba doch akzentreich differenzierte und
auch mit der Lockerheit des dämonischen Scherzos den Zyniker
potent und facettenreich gestaltete: insgesamt die souveränste
Bühnenfigur dieses Abends. Walter Fraccaro konnte seinen
schlanken Tenor am besten in den lyrischen Passagen entfalten, aber
was er in «Cielo e mar» und im Duett mit Laura (Mariana
Pentcheva mit üppigem Mezzosopran) an ausdrucksvollem Profil
zeigte, relativierte sich schnell in deklamatorischen Passagen von
wenig Substanz und steifem Agieren. Umgekehrt Sylvie Valayres
Gioconda, stark und agil im Dramatischen, mit knappen Reserven
allerdings in den expansivsten Momenten, vor allem aber
unausgeglichen, mit manchmal fast brüchigem Timbre, im
Mezzavoce-Bereich. Bei aller Intensität, die dabei immer im
Spiel war: So ganz erwärmen konnte man sich auch für diese
Figur nicht, deren heftige Zerrissenheit zwischen der
Engelsfrömmigkeit (an der Seite der blinden Mutter, die von
Francesca Franci mit ruhiger Präsenz eindrücklich gestaltet
wurde) und der um ihre Liebe kämpfenden Löwin ihren
eigentlichen Grund im Theatralisch-Spekulativen nie ganz verleugnen
konnte.
Wenig inspiriert
Vielleicht hätte die Inszenierung einiges tun
können, um dem entgegenzuwirken. William Orlandis
Venedig-Bilder, die sich auf weniges (De-Chirico-Arkadezur Seite,
schwarz glänzendes Wasser im Vorder- und Hintergrund)
konzentrierten und für den zweiten Akt mit dem Deck des
Schiffes, das am Ende in Flammen aufgeht, eine szenisch
überzeugende Lösung fanden, boten dazu die Voraussetzung.
Gleich die erste Szene, der Auftritt des Chores, der tanzenden
Commedia-dell’Arte-Figuren und des in der Regatta
ausgeschiedenen Zuane (Giuseppe Scorsin), geriet aber in einer Weise
hölzern, die nichts Gutes erahnen liess. Wie der Regisseur
Gilbert Deflo, der mit dem originellen Doppelabend mit
«Thérèse» und «Cavalleria
Rusticana», aber auch «Rigoletto» (auch der ein
Stück nach Victor Hugo!) in Zürich schon eine
glücklichere Hand gehabt hat, das Geschehen dann abwickelte,
wirkte im besten Fall nach gekonnter Routine, aber kaum je inspiriert
und vom Einfall gesegnet. Am stärksten vielleicht gerade in
ihrer Schlichtheit überzeugte die grosse Szene des dritten Aktes
mit dem unspektakulär, aber musikalisch duftig choreografierten
«Tanz der Stunden» (Berta Vallribera Mir), während
die Inszenierung im vierten Akt – auf geradezu entblösst
wirkender Bühnenfläche an Stelle von Giocondas
improvisiertem Zuhause – nicht einmal gegen unfreiwilliger Komik
gefeit war.
|
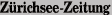 24. 3. 2003
24. 3. 2003
Opernstaub von vorvorgestern
Nach über 80 Jahren
kehrt «La Gioconda» von Amilcare Ponchielli ans Opernhaus
zurück
Wäre da nicht Maestro Nello Santi
am Dirigentenpult, magistral gebietend mit spürbarer Liebe zur
Sache, man könnte diesen opernitallenischen
Wiederbelebungsversuch vergessen. Auf der Bühne kommt nichts zum
Leben, nichts zur Anschauung, nichts über die Rampe.
Entsprechend flau reagierte das Publikum.
WERNER PFISTER
Einst war sie ein beliebtes Primadonnen-Vehikel,
Ponchiellis «La Gioconda»: Keine der
überlebensgrossen Primadonnen - von Arrangi, Lombardi über
Callas, Cerquetti, Milanov und Tebaldi bis zu Caballé - wollte
darauf verzichten. Da die Spezies solcher Primadonnen heute
ausgestorben scheint, hat das Werk seine einstige Präsenz so
ziemlich eingebüsst. Und, Hand aufs Herz, wen interessiert noch
eine Geschichte, wo der Sopran in den Tenor verliebt ist, dieser aber
die Mezzosopranistin liebt, die ihrerseits bereits mit dem Bass
verheiratet ist. «Es ist eine alte Geschichte», hat
Heinrich Heine diesen Sachverhalt einst zusammengefasst («Ein
Jüngling liebt ein Mädchen, die hat einen andern
erwählt; der andre liebt eine andre ... »), und es stellt
sich also die Frage, wie man heute eine solche Geschichte noch einmal
erzählt.
Rampensingen
Um dieses Heute aber scheint es dem Regisseur Gilbert
Deflo und seinem Ausstatter William Orlandi kaum zu tun gewesen zu
sein. Was sie auf die Bühne stellen - das Wort im eigentlichen
Wortsinn gemeint, denn über mehr als ein «Stellen»
von Personen und Situationen geht es nicht hinaus, von Regie kann da
kaum die Rede sein -, ist staubige Opernästhetik der
fünfziger Jahre, als noch Oberspielleiter fürs szenische
Arrangement verantwortlich waren. Für die Sänger und den
Chor heisst das immer wieder: viel Rampensingen, viel Herumstehen und
Warten. Zudem belasten lange Umbaupausen die Aufführung.
Die typische Szenerie Venedigs wird mit wenigen
Akzenten nachgebaut: stilisierte Arkaden, Dogenpalast, die Silhouette
von San Marco, ein Gondoliere. Eher Bildsymbole, realistisch
allenfalls im zweiten Akt, wo das Schiff des Fliegenden
Holländers angedockt zu sein scheint. Doch die Handlung, sie
entfaltet sich in einem unbekümmerten, gleichförmig
opernverstaubten Realismus. Wenn Gioconda ihrer blinden Mutter die
Hände entgegenstreckt, um sie zu führen, streckt ihr auch
die blinde Mutter die Hände entgegen. Wenn Laura von zwei
Männern als Halbleiche aus einer Gondel gehievt und über
die Bühne in ein Schlafzimmer getragen wird, ist das für
die Männer offensichtlich eine derart schwere Last, dass das
Publikum sich hörbar zu amüsieren beginnt.
Stehtheater
Und dann die Ballette (Choreografie: Berta Vallribera
Mir). Tänzchen, so niedlich und nett, als wäre die Zeit und
damit die choreografische Kunst, lange bevor es je ein Fernsehballett
gab, still gestanden. Der berühmte «Tanz der
Stunden» wirkt ungefähr so, als hätten
Ballettelevinnen soeben einen Einführungskurs auf dem Monte
Veritä absolviert. Was solcherart zur szenischen Anschauung
kommt, hat mit der visuellen Welterfahrung des heutigen Menschen kaum
etwas zu tun. Denn so wie die Welt komplizierter geworden ist, sind
auch die Bilder, in denen wir sie wahrnehmen, komplizierter geworden,
vor allem durch deren unendliche und immer raffiniertere Spiegelung
in den Medien. Und durch die Filmkunst.
Schauspielerlsch (sehr) mager
Das Schauspielerische - insofern man daran eine
entsprechend ambitioniertere Erwartung stellt - bleibt eigentlich
inexistent: Alles wird dem Lauf der Dinge überlassen; die
Sänger bleiben sich selbst überlassen. Stehtheater mit viel
Gestik. Auch sängerisch wirkt diese Neuinszenierung blass.
Sylvie Valayre in derTitelpartie verfügt zwar über eine
sichere Höhe, singt aber eindimensional und ohne die nötige
Wortintensität; - zudem stören die heiseren Trübungen
ihres Soprans. Juan Pons (Barnaba) stemmt seine Töne mit viel
Kraft, aber ohne rechten baritonalen Glanz; da und dort stören
Intonationstrübungen. Ein blasser Bösewicht.
Grossartiges Dlrigat
Walter Fraccaro bringt als Enzo eine bemerkenswert
ausgeglichene, allerdings nicht allzu expansive Tenorstimme ins
Spiel; Roberto Scandiuzzi gestaltet den Alvise mit soignierter
Bassstimme, allerdings ohne machtdespotische Untertöne.
Stimmtypisch wohl am überzeugendsten ist Mariana Pentcheva als
Laura: ein metallfunkelnder, merklich belastbarer Mezzosopran. Auch
Francesca Franci überzeugt als Cieca mit satt grundiertem,
schlank geführtem Mezzo. Ein Sonderlob verdienen Chor sowie
Zusatz- und Kinderchor, von Jürg Hämmerli zu einer
klangintensiven Einheit zusammengefügt
Wie gesagt: Wäre da nicht Maestro Nello Santi. Vom
ersten Ton an, vom kammermusikalisch sich in einzelne Stimmen
verästelnden Preludio an entfaltet er eine suggestiv
verinnerlichte Intensität des Musizierens, wie man sie in dieser
(oft zu plakativem Pauschalismus verleitenden) Musik selten
hört. Da ist die Liebe zum Detail zu spüren und ein
Engagement auch für die Untertöne dieser Partitur -
Düsternis und dunkle Dramatik werden von Santi Takt für
Takt mit Autorität und Sorgfalt ausgelotet. Nichts fehlt hier,
nicht der leidende Tonfall luxuriöser orchestraler Melancholie,
nicht die funkelnde Klangfarbendramaturgie der einzelnen Instrumente,
nicht der weite dynamische Kontrastreichtum eines fabelhaft
aufspielenden Orchesters. Ein grossartiges Dirigat.
|

24. 3. 2003
Gioconda mit
Hochdruckdramatik
Eine düstere Geschichte, die sich
um die Strassensängerin «Gioconda» rankt. Das
Opernhaus Zürich hat Amilcare Ponchiellis einziges Werk, das ihn
überlebt hat, in einer ästhetisch schönen, halb
abstrakten Inszenierung von Gilbert Deflo nach über achzig
Jahren neu produziert. Nello Santi und das Opernhausorchester sorgten
an der Premiere für eine sinnliche und differenzierte
musikalische Umsetzung.
Ponchielli (1834-1886)
gebührt als Vorbereiter des Verismo in Italien ein Platz in der
Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts. Dies aber weniger als Komponist
denn als bedeutender Kompositionslehrer in Mailand, bei dem Pietro
Mascagni und Giacomo Puccini in die Schule gingen. Obwohl Ponchielli
über zehn Opern schrieb, hat er nur mit «La
Gioconda» international Aufsehen erregt. Das von ihm mehrmals
überarbeitete Werk weist mit den Arien «Cielo e mar»
und «Suicido», und mit der im Konzertsaal öfter
gespielten Ballettmusik «Tanz der Stunden» aus dem
vierten Akt unsterbliche musikalische Highlights auf.
Intrige, Gewalt, Verrat, Mord
Doch die kompliziert und düster verstrickte
Story, in der nichts als Intrige, Gewalt, Verrat, Mord und
unglückliche Liebe vorkommen, dauert über dreieinhalb
Stunden. Zwar hat kein Geringerer als der Verdi-Librettis Arrigo
Boito unter seinem Pseudonym Tobia Gorrio das Libretto nach einem
Drama von Victor Hugo eingerichtet, doch wirken die grossen
Gefühle «en masse», die an einer
Strassensängerin aufgefädelt werden, so übertrieben,
dass sie mit der Zeit lächerlich werden. Bei allem Respekt vor
Ponchiellis Orchesterpartitur und seiner Instrumentierungskunst; ein
paar markante Striche hätten dem Stück gut getan.
«La Gioconda» ist eine
Strassensängerin in Venedig, die eine blinde Mutter hat. Diese
wird von einem Spitzel der Inquisition, Barnaba, der Hexerei
bezichtigt. Er will sich damit an der von ihm lüstern begehrten
Gioconda rächen, die ihn zurückweist. Gioconda ihrerseits
ist in Enzo verliebt, dessen Gefühle aber für die Frau des
Inquisitors Alvise Badoero entflammen, die er als seine Geliebte aus
früheren Jahren wiedererkennt. Und just diese Frau Laura ist es,
die Giocondas blinde Mutter von der Hexerei freispricht. Obwohl
Gioconda ihre Nebenbuhlerin so sehr hasst, dass sie sie bei einem
nächtlichen Treffen ermorden will, verhilft sie dieser, als sie
in ihr die Retterin ihrer Mutter erkennt, schliesslich zur Flucht mit
Enzo. Ihre nur schwer nachvollziehbare Selbstlosigkeit geht so weit,
dass sie Laura das Leben rettet, als ihr eifersüchtiger Mann sie
vergiften will.
Pomp gewinnt nicht Überhand
Regisseur Gilbert Deflo gelingt es, diese
düstere und emotional überladene Geschichte in einem halb
abstrakten Bühnenraum (William Orlandi) so zu entschlacken, dass
der Pomp der Grande Opéra nicht die Überhand gewinnt.
Venedig wird mit Gondeln und Masken angedeutet, doch es sind die mit
dezenten Farben charakterisierten Figuren, die in den Massenszenen
überzeugen. Der schlagkräftig singende Chor, der den ersten
Akt dominiert, wird zudem präzise und mit schneller Bewegung
geführt, was viel zur Spannung beiträgt. Auch die kleineren
und später die grosse Balletteinlage, subtil choreografiert von
Berta Vallribera Mir, wirken homogen integriert.
Aus dem Orchestergraben hört man vielschichtige
Stimmungen und einen Bläsereinsatz, der Ponchielli als
erfahrenen Dirigenten einer Blaskapelle durchschimmern lässt.
Entsprechend voluminös ist der Klang, der die Protagonisten vor
allem im Chor-Akt arg bedrängt. Stark prägend ist im ersten
Akt der Bösewicht Barnaba, den Juan Pons mit mächtigem
Organ und wuchtiger Bühnenpräsenz darstellt. Der volle
Einsatz der Stimme ging jedoch etwas auf Kosten der gestalterischen
Differenzierung. Auch die Sorpanistin Sylvie Valary wirkte in der
anspruchsvollen und kräfteraubenden Titelrolle zu Beginn noch
unter akustischem Druck, und sogar der mit viel Vorschusslorbeeren
angekündigte, erstmals in Zürich singende Tenor Walter
Fraccaro kam in der Rolle des Enzo anfangs an seine Grenzen und
presste.
Qualitäten zeigten sich spät
Welche Qualitäten diese so verausgabten
Sängerinnen und Sänger aber tatsächlich haben, zeigte
sich erst in den bereits erwähnten musikalischen Highlights der
Oper. In seiner grossen Arie «Cielo e mar» auf dem Schiff
im zweiten Akt, in der Enzo seine Geliebte zum heimlichen Treffen
erwartet, brachte Fraccaro eine warme Strahlkraft und interessante
Farben ins Spiel. Auch die Laura bekam durch den dunkelerdigen und im
Dramatischen gut geführten Mezzo von Mariana Pentcheva eine
eindrückliche Substanz. Sylvie Valayre wuchs als Widersacherin
und spätere Lebensretterin Gioconda spürbar in den Abend,
wirkte plötzlich wie befreit vom akustischen Druck und
gestaltete ihre «Suicido»-Arie im vierten Akt zum
ergreifenden Höhepunkt des Abends.
Trotz der eher kurzen Auftritte des Inquisitors
Alvise vermochte Roberto Scandiuzzi seinen dunkel strahlenden Bass
wirkungsvoll in Szene zu setzen, und auch Francesca Franci verlieh
der blinden Cieca ein musikalisch wie szenisch beeindruckendes
Profil. Diese gute sängerische Leistung, die auch Nello Santis
Führung zu verdanken ist, kann jedoch nicht darüber
hinwegtäuschen, dass sich diese Oper über einige Szenen
hinweg in ständiger Hochdruckdramatik leerläuft. Mit ein
paar deutlichen Strichen hätte man diesen Längen und
Schwächen entgegenwirken können. So aber hatte man nach
über dreieinhalb Stunden mehr als genug.
Sibylle Ehrismann
|
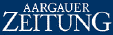
24. 3. 2003
Dramatik der Komik
preisgegeben
Überflüssig
Amilcare Ponchiellis «La Gioconda» am
Opernhaus Zürich
Ein weiteres
Müsterchen aus der Raritätensaison 2002/2003: Leider wird
in keinem Augenblick klar, warum «La Gioconda» gespielt
werden muss.
Christian Berzins
Im Tram ist es einfach: Stört der Sänger,
zahlt man ihm 5 Franken, damit er drei Stationen lang still ist. In
der Zürcher Oper hatten die Parkettbesucher am Samstagabend 270
Franken bezahlt, und trotzdem sangen die Protagonisten immer weiter.
Sie sangen eine Oper, für deren Titelheldin (einmal mehr) Maria
Callas die diskografische Messlatte gelegt hat. Doch das ist
trügerisch, denn die zwei EMI-Einspielungen sind nicht die
besten von Amilcare Ponchiellis (1834-1886) 1876 uraufgeführter
«La Gioconda» - gewisse ihrer Mitstreiter sind zu
durchschnittlich. Diese Oper lässt sich nicht auf eine
Primadonna reduzieren, sie braucht fünf grosse Stimmen und einen
tollen Dirigenten, damit eine traditionelle Inszenierung zu Wirkung
gelangt. Zürich bietet eine sehr traditionelle Inszenierung,
fünf durchschnittliche Stimmen sowie einen seriösen
Dirigenten.
Sylvie Valayre singt die Titelrolle bisweilen mit zartesten
Engelstönen. Doch immer wieder lässt sie sich von der
Dramatik leiten und presst dann ihre Spitzentöne aggressiv
aufgebauscht ins Rund, dass geradezu intonatorische Kuriositäten
zu erleben sind. Ganz anders Juan Pons in der Schurkenrolle des
Barnabas: Er gestaltet seinen Part edel aus dem (bösen) Wort
heraus, der lyrische Ton herrscht fast durchwegs vor. Da Pons aber im
Detail gestalten kann, gelingt es ihm trotzdem, das Schurkische zu
zeigen. Schade, dass (zu) viele Phrasenbrüche den positiven
Eindruck schmälern. Walter Fraccaro (Enzo Grimaldo) ist ein
Tenor, bei dem man nicht merkt, dass seine Töne nach der
Produktion in der Zwerchfellgegend durchs Herz gehen. Egal, ob
«orrore» (Schrecken) oder «amore» (Liebe): Er
singt stereotyp in denselben durchdringenden, trompetenhaften Farben.
Der 42-jährige Roberto Scandiuzzi singt den Alvise so, wie es
Basslegende Nicolai Ghiaurov (Jahrgang 1929) wohl in zehn Jahren tun
wird: Eine pastos aufgehellte Stimme ohne Glanz und Biegsamkeit,
angestrengt in der Tongebung. Mariana Pentchevas dramatischem
Mezzosopran fehlt es an Körper. Der Chor (Leitung Jürg
Hämmerli) hat grosse Aufgaben, meistert sie mässig,
wenigstens spielt das Orchester souverän. Nello Santi gelingt es
aber nicht, einen erzählenden Ton zu erzeugen.
Wenn Santi den
Dirigentenstab führt, dann muss es auf der Bühne so
aussehen wie im verstaubtesten Opernmuseum: Die Kleider sind also
samtig dick, die Kulissen kitschig (Ausstattung William Orlandi), die
Gesten stereotyp, die Interpretation auf ein Nacherzählen der
Handlungsangaben des Librettos reduziert. Und so werden denn die
kuriosen Verstrickungen, die brutalen Intrigen und wilden
venezianischen Leidenschaften des 17. Jahrhunderts mehr zum gemalten
Tableau als zu einem zwingenden Spiel. Regisseur Gilbert Deflo ist
damit zufrieden, auch wenn ein Teil des Publikums buhte. Dass trotz
der Plastikdramatik leidenschaftliche Figuren auf der Bühne
stehen, lässt er ausser Acht, ja schlimmer noch: Die
Protagonisten werden in diesem Drama der unfreiwilligen Komik
preisgegeben. Die Opera buffa, die lustige Oper, erlebt im Verismo
des 19. Jahrhunderts eine Renaissance - derweil la Gioconda, die
Heitere - weint.
|

24.03.03
«La Gioconda» nahe der Parodie
80 Jahre lang ruhte
sie in Frieden, jetzt hat das Zürcher Opernhaus Amilcare
Ponchiellis Oper «La Gioconda» wieder auf die Bühne
gebracht. Mit zwiespältigem Resultat: Das Stück hat
faszinierende Seiten, die Umsetzung liess sehr zu wünschen
übrig.
VON REINMAR WAGNER
Es gab Zeiten - und sie sind nicht so lange her -, wo
kein Klassik-Wunschkonzert ohne Ponchiellis «Tanz der
Stunden» auskam, und die grosse Arie «Cielo e Mar»
hatte jeder Tenor im Repertoire. Beide stammen aus Ponchiellis
«La Gioconda», die Einzige von seinen zehn Opern, die
sich wenigstens halbwegs dem Vergessen entziehen konnte. Denn ausser
den beiden genannten Höhepunkten hat sich wenig halten
können, als ganze Oper wird «La Gioconda» nur sehr
selten auf die Bühne gestellt.
Die verschlungene, unwahrscheinliche Handlung vom
Verdi-Librettisten Arrigo Boito nach einem Drama von Victor Hugo
wurde dafür gelegentlich vorgeschoben, aber abgesehen, dass das
für andere Stücke - siehe «Trovatore» - auch
kein Hinderungsgrund ist, hat die Geschichte von «La
Gioconda» viele romantische Elemente und emotionale
Höhepunkte.
Das Beste war die Bühne
Davon konnte die Zürcher Produktion nicht
profitieren. Das Beste war das Bühnenbild von William Orlandi,
wären da nicht die langen Umbauzeiten in den Pausen: Ein
stilisiertes Venedig, die Arkaden, die Gondeln, die Masken und die
Commedia dell'Arte, alle da, aber mehr als Zitate, denn als wirkliche
Bühnenelemente, und stets getaucht in ein düsteres,
bedrohliches Licht, welches den Sujets von Rache, Mord, Gift,
Intrigen, Eifersucht und Gemeinheit nur zu gut passt. Das üppige
Gold für die Szenen im Palast war dabei als Kontrast nur umso
schlagkräftiger.
Darüber hinaus gab es wenig zu sehen: viele
Herumstehende in vielen farbigen Kostümen, Ballett und Karneval,
und die einzige spannende Frage an Gilbert Deflos Inszenierung blieb:
Gibt es wohl einen Satz, der nicht frontal an der Rampe gesungen
wird? Es gab nicht: Jede Phrase ein Ausrufezeichen, jeder Einsatz ein
Auftritt, jeder Auftritt ein Konkurrenzkampf gegen die anderen um die
grössere Durchschlagskraft des Tons. In Reih und Glied stehen
sie alle auf der Bühne, vor dem Chor, der seinerseits
hübsch aufgereiht stehen bleiben darf, nachdem jeder Chorist
atemlos rennend seinen Platz in der vorgegebenen Zeit erreicht
hat.
Front gegen das Publikum
Bei Deflo gilt: Front gegen das Publikum, wer etwas zu
singen hat, tritt zwei Schritte vor, wenn er fertig ist, marsch
zurück ins Glied. Weitergehende Anweisungen schien es vom
belgischen Regisseur nicht gegeben zu haben, womit die
unterschiedlichen individuellen darstellerischen Fähigkeiten zum
Tragen kamen: besser, manchmal sogar richtig glaubhaft und
anrührend bei Sylvie Valayre in der Titelrolle und ansatzweise
bei Francesca Franci und Roberto Scandiuzzi, schon weniger bei Juan
Pons, welcher die abgrundtiefe Schwärze der Seele des
Intriganten Barnaba, ein würdiger Vorläufer von Verdis
Jago, nicht glaubhaft zu machen verstand. Und erbarmungswürdig
beim Tenor Walter Fraccaro und noch mehr bei Mariana Pentcheva, die
beide all die verstaubten Sängergesten kultivierten, über
welche sogar das Zürcher Premierenpublikum mittlerweile lachen
kann. Wenn man eine Opernparodie veranstalten wollte, man könnte
es nicht besser machen. Und sogar für die sängerische Seite
dieser Produktion galt manchmal dieses nicht eben schmeichelhafte
Verdikt: Wenn sich wirklich potente Stimmen gegenseitig an die Wand
zu singen versuchen, kann das ja noch einen gewissen Reiz haben, als
sportlicher Wettstreit und aus der reinen Lust an geschmetterten
Tönen, wovon die Oper grundsätzlich ja nie frei ist. Aber
wenn es Stimmen sind, die besser daran täten, sich mit Mass und
Intelligenz um ihre Grenzen zu kümmern wie vor allem bei Juan
Pons, dann sollten sie sich auf solche Duelle nicht einlassen.
Schon in der Mitte am Ende
Pons war bei seiner grossen Szene schon in der Mitte am
Ende, bei Walter Fraccaro (und manchmal auch bei den anderen)
driftete die Intonation vor lauter Anstrengung in abenteuerliche
Sphären ab, Sylvie Valayre verlor fast alle Klangfarben und
Ausdrucksnuancen, wobei sie die Einzige war, die hin und wieder auch
erfolgreich ein Piano wagte. Und bei Mariana Pentcheva liess sich das
wabernde Vibrato schon längst nicht mehr unter Kontrolle halten.
Am besten zurecht in diesem Sängerkrieg kamen der strahlende
Bariton von Roberto Scandiuzzi, die einzige wirklich bezwingende
Stimme dieses Abends.
|
 25. 3. 2003
25. 3. 2003
Ponchiellis Schauerdrama um Gift und
Dolch
Nello Santi dirigierte
am Opernhaus Zürich Amilcare Ponchiellis Dramma lirico «La
Gioconda». Der Abend lässt viele Fragen
offen.
Leidenschaft, Liebe, Hass,
Intrigen, Mord, Gift, Verrat - das sind die Affekte die «La
Gioconda» (1876) prägen, eines der düstersten Werke
der Opernliteratur. Dennoch hat der italienische Komponist Amilcare
Ponchielli (1834-1886) eine über weite Strecken melodiöse
Musiksprache dafür gefunden, die bereits auf den Verismo
verweist. Mit dem Librettisten Arrigo Boito (der für Verdi die
Textbücher zu «Otello» und «Falstaff»
schrieb) hat Ponchielli um die Verse gerungen. Die vieraktige
Grand-Opéra basiert auf Victor Hugos Drama «Angelo,
Tyrann von Padua». Boito verlegte die Handlung ins Venedig des
17. Jahrhunderts. Da ist der Karneval nicht weit.
Verworrene Handlung
Regisseur Gilbert Deflo nimmt diesen Faden gerne auf. Die
Massenszenen zeigt er als grosse, jedoch statische Tableaux. Sein
Ausstatter William Orlandi schuf mit abstrahierender Bildsymbolik ein
Venedig um 1800: den Markusplatz vor blauem Himmel, ein riesiges
Schiff, einen Fest-saal und die öde Ge-gend am Kanal Orfano.
Zusammen mit der raffinierten Lichtregie (Hans-Kunz) ergibt dies
immer wieder eine stimmungsvol-le Atmosphäre - überzeugend
vor allem in den intimen Szenen.
Die Handlung der Oper ist verworren und für das
heutige Publikum kaum nachvollziehbar - eine Schauergeschichte mit
mehrfach tödlichem Ausgang. Der Regisseur unternimmt gar nicht
erst den Versuch, die Figuren glaubhaft auszuleuchten. Es scheint,
als setzte Deflo auf die individuellen schauspielerischen
Fähigkeiten seiner Protagonisten. Für unfreiwillige Lacher
sorgt er im Schlussakt, als zwei Gondolieri die scheintote Laura wie
einen Sack Kartoffeln über die Bühne schleppen.
So sind denn die Sängerinnen und Sänger auf
sich allein gestellt. In Maestro Nello Santi haben sie einen
Dirigenten, der sie auf Händen trägt. Santi - wie immer
auswendig dirigierend - musiziert mit dem Orchester der Oper
Zürich wunderbar differenziert, vom filigranen Streicherklang
bis zu mächtiger, dramati-scher Aufladung in den Massenszenen.
Auch der verstärkte Chor trumpft gewal-tig auf. Originell
chographiert wurde das berühmte Ballett «Tanz der
Stunden» von Berta Vallribera Mir.
Aufstrebender Tenor
Offenbar kurzfristig kam es zu zwei wichtigen
Umbesetzungen (Laura und La Cieca). Die Bulgarin Mariana Pent-cheva
als Laura Adorno überzeugte mit sattem, rundem Mezzo, Francesca
Franci als blinde Mutter nahm mit sonorer Altstimme für sich
ein. Die grösste Überraschung des Abends bot der junge
italienische Tenor Walter Fraccaro in seinem Rollendebüt als
Enzo Grimaldo. Er sang mit warmem Timbre, Strahlkraft und Schmelz
glei-chermassen verströmend. Ein Höhepunkt seine Arie
«Cielo e mar». Der Spanier Juan Pons gab den Intriganten
Barnaba wohltuend fern von jeder billigen Schmierigkeit mit
vollklingendem Bariton. Überzeugend der Bassist Roberto
Scandiuzzi als Alvise, der seine Gattin Laura zum Gifttod
anstiftet.
Zwiespältige Gioconda
Bleibt die sich aufopfernde Strassensängerin
Gioconda von Sylvie Valayre. Die Französin machte in Zürich
als Abigaille Furore. Ihre Stimme klang am Premierenabend seltsam
verschleiert und belegt. Die Spitzentöne kamen angestrengt, die
Mittellage gab kaum Farben her, satt war nur die Tiefe.
Darstellerisch wirkte ihre Gioconda allzu umtriebig. Erst im
Schlussakt («Suicidio!») konnte die Valayre ihren
dramatischen Sopran in ein besseres Licht stellen. Der Jubel für
die Ausführenden nach dem fast vierstündigen Abend (mit
einer 25-minütigen «Lichtpause»!) war gross, aber
ungewöhnlich kurz. Am stärksten gefeiert wurde Maestro
Santi.
|
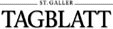 25. 3. 2003
25. 3. 2003
Ponchielli ausgegraben
Musikalisch überzeugt
die Aufführung von Amilcare Ponchiellis «La
Gioconda», die im Zürcher Opernhaus zur Premiere kam. Die
szenische Umsetzung hingegen ist statisch und voller Brüche.
Nello Santi zeigt bereits in der Ouvertüre, was er aus dem
Orchester herauszuholen vermag. Sehr gesanglich spielen die Musiker
die weit ausladenden Melodielinien, um sich dann und wann zu einem
bombastischen Fortissimo zu steigern. Es gelingt Santi, das Geschehen
voranzutreiben und grosse Bögen zu spannen. Dies ist umso
nötiger, als die 1876 uraufgeführte Oper als Ganze recht
uneinheitlich wirkt. Die Handlung der «Gioconda» ist
reichlich verworren, die Psychologie der Figuren schlicht
unglaubwürdig. Regisseur Gilbert Deflo, der in Zürich
zuletzt «Rigoletto» inszeniert hat, unternimmt nichts, um
die Heterogenität des Werks auszugleichen. Die Sängerinnen
und Sänger liessen sich erstaunlich wenig beeindrucken. Sylvie
Valayre, in Zürich bereits als Abigaille (Nabucco) gefeiert,
gibt eine begeisternde Gioconda. Die Pariserin kann, bei aller
Dramatik, auch ganz leise singen. Walter Fraccaros Tenor klingt bis
in höchste Höhen wunderbar geschmeidig, während Juan
Pons den Bösewicht Barnaba ganz schön diabolisch spielt und
singt. (sda)
|

25. 3. 2003
Mord, Gift und Rosenkranz
Die Oper
kocht: Amilcare Ponchiellis Reißer "La Gioconda" mit
Nello Santi in Zürich
Nichts mit Musiktheater, schon gar nichts mit
dem, was Regietheater genannt oder, je nach Neigung, auch gescholten
wird. Das Dechiffrieren tiefgründelnder Deutungsabsichten hat in
Zürich Pause. Was sich in der jüngsten Neuinszenierung dort
zuträgt, gehört ins Kapitel der Opernschlachten. Wir sehen
uns einer Arena der sich hochschaukelnden Emotionen gegenüber,
einem Wettstreit der vokalen Affekte. "La Gioconda" von
Amilcare Ponchielli (1834 bis 1886) - das ist einer jener Abende, an
denen die Oper kocht.
Obwohl wir auch hier ein paar wundersame verbale Erfindungen
registrieren, wusste Arrigo Boito, später Verdis
"Otello"- und "Falstaff"-Librettist, warum er
sein Namens-Anagramm Tobia Gorrio verwendete. "La Gioconda"
von 1876 und danach etliche Male umgearbeitet ist eine
Schauergeschichte frei nach Victor Hugo - eine von Gut und Finster,
von Rosenkranz und Giftphiole, von heimlicher Liebe und Verrat, von
Leidenschaft, Erpressung und Verleumdung, von Eifersucht und
Entsagung, Intrige und Zufall. Kurz, alle Opernzutaten sind so gut
wie lückenlos versammelt.
Einmal losgetreten, läuft die Schauermär von
selbst. Man braucht dazu sechs hochkalibrige Kehlen, am besten von
der Marke Star, und das Gescheiteste ist, man arrangiert ihr Mit- und
Gegeneinander einigermaßen vernünftig. So verfuhr Gilbert
Deflo, von dem man Besseres kennt - Motto: Wie komme ich mit dem
geringstmöglichen Ideenaufwand durch drei Opernstunden? Das
Händeringen als Gipfel der Darstellungskunst. In Zürich
residieren der große szenische Gedanke und die entwaffnende
Schlichtheit ja in trauter Nachbarschaft. Und William Orlandi macht
mit seiner Bühne, seinem Kostümaufwand jederzeit klar, dass
wir in Venedig sind - ob im 17. Jahrhundert des Originals und um 1800
wie hier, ist schnurzpiependeckelegal.
Die Sänger fühlen sich sicher wie in Abrahams
Schoß
Für dergleichen hat Zürich seit 45 Jahren Nello
Santi. Der braucht auch hier keine Partitur und weiß doch
haargenau, wie man diese Mixtur aus althergebrachter Ensemblekunst ,
Grand-Opéra-Pomp und vorweggenommener Verismo-Rabiatheit
aussteuert - al fresco, aber mit maximaler Wirkung. Ponchiellis
raffiniertes Kontrastkomponieren ist bei ihm in den richtigen
Händen: wie da auf ausgelassenen Tanz ohne Einschnitt Orgelklang
und frommer Chorgesang folgen, wie Serenadenheiterkeit hereindringt,
dieweil der betrogene Gatte seiner Frau den Tod ankündigt. Die
Sänger fühlen sich bei Santi sicher wie in Abrahams
Schoß. Und Zürich bringt auch hier wieder zusammen, was
auch an der Scala oder der "Met" gut und teuer ist.
Vorneweg Sylvie Valayre in der mörderischen Titelpartie,
in der einst Maria Callas in Verona ihre Weltkarriere startete.
Aufschwung um Aufschwung nimmt sie. Die gewaltigen Bögen spannt
sie mit hochdramatischer Inbrunst - imponierend und dabei um
Zwischentöne bemüht. Mit ihrer verheirateten Rivalin Laura
liefert sie sich ein wild wogendes Duettduell. Mariana Pentchevas
Mezzosopran ist die Vulkanstimme, die hier vonnöten ist -
fabelhaft. Für Giocondas blinde Mutter ist Francesca Francis Alt
reichlich jung - dennoch bietet sie den Ensembles das rechte
Fundament.
Drei
Promis als Partiendebütanten bei den Herren - auch das ist
Zürich. Walter Fraccaro ist als Enzo ein echter Spinto, ein
jugendlich-dramatischer Tenor, leicht ansprechend und mit
glänzendem Kern. Hätte er noch ein paar Piano-Momente
für seine berühmte Romanze "Cielo! e mar!",
wäre das Belcantoglück perfekt. Aber auch so: Strahlenderen
Tenorgesang gab es lange nicht. Juan Pons' Spion Barnaba ein
Vorläufer von Verdis Jago: rau und mächtig im
charakterbaritonalen Ausbruch. Roberto Scandiuzzi als gehörnter
Chef der Staatsinquisition: beinahe schon zu sehr dröhnende
Basswucht.
|

